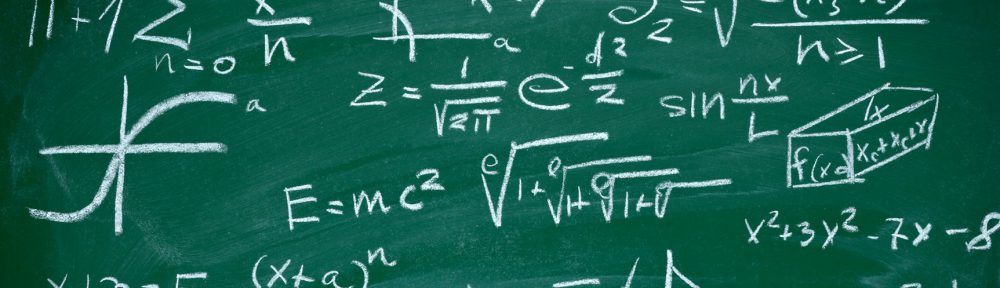Die Digitalisierung unserer Gesellschaft und das Interesse für digitale Spiele schreitet mit sehr großen Schritten voran. Diese Tatsache ruft auch Experten, Unternehmen, Pädagogen und Pädagoginnen auf den Plan. Gefördert durch das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und den Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU), starteten das Institut Spielraum an der TH Köln und die Stiftung Digitale Spielkultur ein gemeinsames Projekt in Form der Plattform digitale-spielewelten.de.
Vom digitalen Spiel zur Realität
Sehr viele Kinder und Jugendliche nutzen heutzutage digitale Spiele in ihrem Alltag – ob an der Konsole, über das Internet oder mobil. Das digitale Spiel im Unterricht kann somit ein Zugang zu Kindern und Jugendlichen sein, da sich die digitale Selbstanschauung und das digital kreierte Weltbild der Kinder und Jugendlichen zumeist sehr nah an der Realität bewegt. Dies ermöglicht den Pädagogen und Pädagoginnen, mit Hilfe ausgewählter Spiele und deren Geschichten, Themen wie z.B. Angst, Verlassenheit, oder Körperlichkeit spielerisch anzugehen. Die virtuellen Welten bieten vielfältige Resonanzräume für die Identitätsarbeit. In einem kürzlich erschienenen Flyer, werden Beispielthemen in drei Hauptthemenblöcke geordnet: Identität, Flucht und Vertreibung, sowie Gender & Games.
Der Zugang zu Normen und Werten
Digitale Spiele erfreuen sich bei Kindern und Jugendlichen einer derartigen Beliebtheit, dass es fast notwendig erscheint, hierfür einen pädagogischen Ansatz zu finden. Diese ausgeprägte Beliebtheit der digitalen Spiele, bietet einen neuen Zugang zu essentiellen Lebensfragen und deren Diskussion und Aufarbeitung. Der Inhaltliche Aufbau von digitalen Spielen und deren Geschichten, basieren zumeist auf Themen die Teil unserer realen Welt sind, oder es zumindest einmal waren. Identitäre Fragen, wie bspw. „Wer bin ich?“, „Wer möchte ich sein?“ und „Wie habe ich mich zu verhalten?“, sind zentrale Fragen – sowohl innerhalb eines digitalen Spiels, als auch im wahren Leben. Mit Hilfe des „Türöffners“ digitales Spiel, bietet sich Pädagogen und Pädagoginnen die Möglichkeit, zentrale ethische und identitäre Fragen mit den Schülern zu besprechen und aufzuarbeiten. Die Selbstreflexion ist insbesondere bei komplexen Situationen – sowohl im realen Leben als auch in der digitalen Welt – ein sehr wichtiger Aspekt, der durch die Aufarbeitung der im Spiel vorkommenden Situationen gefördert werden kann.
Ein besonderes Thema der pädagogischen Arbeit mit digitalen Spielen, bietet die Sexualisierung des Frauenbildes. In vielen Spielen werden Frauen mit besonders großer Oberweite, verpackt im viel zu kleinen Dress oder unrealistischer Verkleidung dargestellt. Meist dienen die weiblichen Rollen einzig und allein der „Unterstützung“ der männlichen Hauptrolle. Doch auch die Darstellung der männlichen Charaktere ist teils sehr diskutabel. So werden männliche Charaktere oftmals in absolut dominanten und „übermächtigen“ Rollen dargestellt, die sich vor allem in Stärke und Kampfkraft äußert. Empathie und Kompromissbereitschaft werden als Schwäche gesehen, oder spielen keine Rolle. Um diese identitären und ethischen Fragen und Aufgaben einordnen zu können, scheint ein pädagogischer Zugang in Form einer Inklusion digitaler Spiele in den Unterricht sehr sinnvoll zu sein.