Auf ein erfolgreiches Start-Up kommen schätzungsweise neun ins Straucheln – ähnlich wie beim Pokern. Auch der Gründungssaldo wird von Jahr zu Jahr schlechter. Und das, obwohl das Selbstbewusstsein der Gründer immer größer zu werden scheint:
„Ob nun Größenwahn oder Naivität Erklärungsansätze für dieses Verhalten liefern, lässt sich nicht feststellen, aber viele Gründer spielen offenbar gegen die Wahrscheinlichkeit.“
Das Institut für Ludologie hat sich nun dieser Frage gewidmet und beschreibt in seinem Artikel „All in?!- Was Start-Ups vom Pokern lernen können“ wie die Wissenschaft vom Spiel und seinen Elementen auf eine betriebswirtschaftliche Ebene gehoben werden kann. Der Artikel erschien im Rahmen des kürzlich publizierten Buches Spielräume, das sich mit den Facetten von GAMIFICATION in Unternehmen auseinandersetzt.
Pokern und der Begriff des Erfolgs
Das gleiche gilt laut Institut für Unternehmen: Denn erst wenn der Erfolgsbegriff über das Messbare hinaus erweitert werde, könne ein Bewusstsein für organisationale Selbstreflexion und Nachhaltigkeit geschaffen werden. In diesem Spiel gewännen flexible Organisationen, die die Notwendigkeit erkannt haben ihr operatives Verhalten stetigem Feedback des Marktes auszusetzen. Ebenso wichtig sei das Hinterfragen von organisationsinternem Wissen (Ressourcen, Fähigkeiten, Fertigkeiten). In Verbindung mit der Beobachtung seines Umfeldes, helfen ein kritischer Blick auf die Kulturebene und ein ganzheitlicher Blickwinkel. In Kombination könne ein ungeahntes Maß an Anpassungsfähigkeit und Wendigkeit zu erreicht werden. Nur wenn dies gegeben sei, könnten Unternehmen eine Offenheit für Veränderung und ein wachsames Auge für inneres und äußeres Ungleichgewicht erlangen.
Auch wenn das wirtschaftliche Spielfeld und die Spielregeln sich verändern, können selbstreflektierende Unternehmen sich durch ihr organisationales Selbstverständnis beinahe mühelos an die neuen Spielbedingungen anpassen. Veränderungsimpulse ließen sich dabei auf operativer, taktischer uns strategischer Ebene identifizieren. Ählnich wie in der Metaebene des Pokerspiels.
Pokern als Methode
Statistisch gesehen, ist die langfristige Gewinnwahrscheinlichkeit beim Roulette höher als bei einem Start-Up. Doch woran liegt es, dass einem Glücksspiel höhere Chancen auf Erfolg eingeräumt werden kann, als einer Unternehmensgründung?
Der Spieler selbst ist die Hautfigur im Einschätzen der Gesamtsituation. „Ein schlechter Spieler kann zwei Asse sehr schlecht spielen, ein guter Spieler wird das Maximum aus seinen Karten herausholen“. Im Klartext bedeutet das: Spieler/Unternehmen die dazu in der Lage sind ihre Handlungsoptionen jenseits des Offensichtlichen zu erschließen, sind auch dazu in der Lage selbstreflektierend zu agieren.
Die Beobachtungen, innerhalb des Artikels beziehen sich auf die Cash Variante des Spiels Texas Hold‘em. Texas Hold‘em Poker ist ein Spiel mit 52 Karten und max. 10 Spielern. Neben dem Zufall wird das Spiel durch Psychologie und Strategie beeinflusst. Die Spielregeln sind sehr simpel und das Spiel unterliegt keinem klassischen Spielende. Mitspieler können sich jederzeit in das laufende Spiel einkaufen, oder es verlassen. Ziel des Spiels ist es, entweder alle anderen Mitspieler zum Ausstieg zu bewegen, oder am Ende die besten Karten auf der Hand zu haben. Diese Spielsituation ist der Unternehmenssituation von Start-Ups sehr ähnlich.
Spielregeln erster Ordnung
Die Spielregeln erster Ordnung beschreiben die expliziten Regeln des Spiels. Gute Pokerspieler spielen jedoch über diese expliziten regeln hinaus. Denn sie wissen, dass das Verhalten und die Reaktionen der anderen Spieler sowie ihr eigenes Verhalten in einem größeren Kontext für den Erfolg ausschlaggebend sind.
Dagegen fehlt unerfahrenen Spielern oftmals die Impulskontrolle, was dazu führt, dass sie verlieren. Ein Spieler der viel gewonnen, oder verloren hat, reagiert darauf unbewusst durch die Art und Weise wie er seine nächste Hand ausspielt. Erfahrenen Spielern können sie jedoch nichts vor machen, denn diesen ist dieser Einflussfaktor durchaus bewusst. Sie können reflektieren und darauf eingehen.
Auch in Start-Ups ist dieses Bewusstsein von essentieller Bedeutung, denn auch hier spielt Risiko eine Rolle.
Eine Verhaltensorientierte Organisation lässt sich daher gut mit einem Amateur-Pokerspieler vergleichen: Er kennt die Regeln erst seit Kurzem und kann nur auf ein begrenztes Wissenskontingent zurückgreifen. Er ist gierig und hat ein emotionales Verhältnis zu seinen Karten (seinem Produkt), deshalb möchte er diese einfach spielen und gibt damit die Kontrolle an die Regeln der Wahrscheinlichkeit und an seine Gegner ab.
Mit Produktideen ist es oft ähnlich: durch den festen Glauben an das Produkt mangelt es an Selbstreflexion. Auch was um das Unternehmen (den Spieler) herum geschieht wird übersehen und deshalb kann er sich auch nicht adäquat dazu verhalten. Diese mangelnde Reflexion bei der Gründung ist oftmals auschlaggebend für das Scheitern.
Spielregeln zweiter Ordnung
Laut Institut, müssen Unternehmen weg von der operativen Hektik und hin zu einem ganzheitlichen Bewusstsein, einer wissensorientierten Perspektive. Nur so kann ein Spieler ein Verständnisniveau erreichen, welches ihm ermöglicht komplexe Wirkungszusammenhänge und Ursachen zu verstehen. In der Praxis bedeutet das, dass der Spieler zum Beobachter wird und die Handlungen aller Spieler ins Verhältnis zueinander setzt. So kann er über die expliziten Spielregeln hinaus agieren. Das Hinterfragen der eigenen Handlungen und des eigenen Verhaltens erweitert seinen Handlungsspielraum und ermöglicht somit alternative Verhaltensweisen, mit denen er seine Wettbewerber ausstechen kann.
Spielregeln dritter Ordnung
Als letzter Schritt kommt die bewertende Perspektive. Der Beobachter erlangt in dieser Metaebene ein Bewusstsein für die eigene organisationale Identität (Werte, Normen etc) und gleicht diese permanent mit der externen erfunden Ordnung (den Spielregeln) ab. So ist er in der Lage unentwegt alternative Selbstkonzepte zu entwickeln, die mit dem Spielfeld (regulativen Rahmenbedingungen) und der eigenen Identität im Einklang sind.
Ein Profi-Pokerspieler erlangt über die Jahre ein kulturorientiertes Bewusstsein. So kann er seine Spielstrategie fließend an das Verhalten seines Gegners anpassen. Er löst sich von fremd definierten Zielen und definiert eigene. Dem Kontrollverlust der eigenen Situation durch Regularien kann er mit dem Ändern seiner Spielziele, oder einem rechtzeitigen Ausstieg entgegenwirken. Das ist jedoch nur möglich, wenn ein Spieler sich selbst hinterfragt und es schafft eine Vogelperspektive einzunehmen.
Zusammenfassung
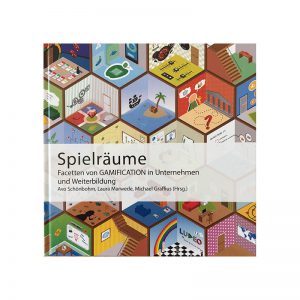 Die drei Verständnisebenen der ludologischen Perspektive bieten einen Ansatz für den Umgang mit Komplexität, der Bewertung von Situationen und der Selbstreflexion. Für ein nachhaltiges Wachstum ist die organisationale Selbstreflexion also entscheidend. Denn nur so kann ein Unternehmen seine operative, taktische und strategische Anpassungsfähigkeit wahren, ohne sich selbst aufzugeben.
Die drei Verständnisebenen der ludologischen Perspektive bieten einen Ansatz für den Umgang mit Komplexität, der Bewertung von Situationen und der Selbstreflexion. Für ein nachhaltiges Wachstum ist die organisationale Selbstreflexion also entscheidend. Denn nur so kann ein Unternehmen seine operative, taktische und strategische Anpassungsfähigkeit wahren, ohne sich selbst aufzugeben.
Wer noch mehr zum Thema Gamification wissen möchte, findet in Spielräume einen perfekten Einblick: Zum Beispiel wie Spiele zur Kulturtransformation in Unternehmen beitragen, oder wie die Mitarbeiter-Motivation in der Gastronomie durch Gamification gestärkt werden kann.
Bildquellen: www.pexels.com, www.flying-kiwi.de

